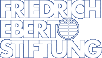Demokratie in Deutschland 2011
Die Demokratie der Bundesrepublik Deutschland zeichnet sich trotz formal gleicher politischer Rechte nach wie vor durch eine quantitative und qualitative politische Unterrepräsentation von Frauen aus. Sie ist daher noch immer als "Androkratie", also als "Männerherrschaft", zu bezeichnen. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Entdemokratisierung kann ein neuer "Geschlechtervertrag" zur generellen Demokratisierung der Demokratie beitragen.
Demokratie und Geschlecht
Trotz formal gleicher politischer Rechte und obwohl Frauen in der politischen Partizipation und Repräsentation in den vergangenen 30 Jahren mit den bundesdeutschen Männern gleichgezogen haben und in der Politik "sichtbarer" wurden, zeichnet sich die Demokratie der Bundesrepublik Deutschland nach wie vor durch eine quantitative und qualitative politische Unterrepräsentation von Frauen aus. Frauen haben in der bundesdeutschen Demokratie noch immer weniger politische "Stimme" als Männer – eine Bundeskanzlerin erscheint eher als eine Ausnahme denn die Regel. Vor allem aber werden die Interessen von Frauen weit weniger berücksichtigt, wie zuletzt die Rettungsaktionen aus der Wirtschafts- und Finanzkrise zeigten. Sogenannte Rettungsschirme wurden eher für Männerarbeitsplätze, insbesondere in der industriellen Arbeit, nicht aber für jene Tätigkeiten aufgespannt, die im Rahmen der geschlechtsspezifi schen Arbeitsteilung vornehmlich von Frauen geleistet werden, wie den Einzelhandel oder den Dienstleistungsbereich. Kurzum: Die Bundesrepublik ist noch immer eher als "Androkratie", also als "Männerherrschaft", denn als "Demokratie", also als "Volksherrschaft", zu bezeichnen.
Die bundesdeutsche Demokratie weist höchst paradoxe Entwicklungstrends auf. Die formal gestiegene quantitative Repräsentation von Frauen geht mit einer generell sinkenden politischen Beteiligung in formalen demokratischen Verfahren und mit einer Tendenz der Entmächtigung der Bürgerinnen und Bürger einher. Aus einer Geschlechterperspektive ist bemerkenswert, dass sich politische Entscheidungen zunehmend jenen demokratischen Gremien entziehen, zu denen sich Frauen durch Quoten einen Zugang erkämpft haben: Politische Entscheidungen werden zunehmend in supranationalen Gremien wie der Welthandelsorganisation, der Europäischen Union oder in Vorstandsetagen multinationaler Konzerne sowie in den "Hinterzimmern" der nationalen sogenannten Verhandlungsdemokratien getroffen. In engem Zusammenhang damit steht ein gestiegenes zivilgesellschaftliches Engagement als Ausdruck der Unzufriedenheit mit den politischen Repräsentantinnen und Repräsentanten, der Informalisierung von Politik und dem Diskurs des Sachzwangs, der nur wenig Spielraum für politisches Handeln lässt.
Im Zeitalter ökonomischer Globalisierung und politischer Internationalisierung sowie der Verschiebung politischer Macht in gesellschaftliche Gremien stellt sich also die Frage der Demokratisierung völlig neu. Öffnen sich damit geschlechterdemokratische Chancen in der "postnationalen" Demokratie? Während das demokratische Institutionengefüge historisch auf der Ebene des Nationalstaats angesiedelt ist, bedarf Demokratisierung im Kontext politischer Internationalisierung einer supranationalen Dimension wie auch eines deutlich kleinräumigeren Bezugs: Kommunen und Regionen werden für die demokratische Partizipation und Entscheidung immer wichtiger. Sie bieten Möglichkeiten für eine geschlechtersensible Verknüpfung von Frauenbewegung und institutioneller Frauenpolitik – möglicherweise sogar zahlreichere als die männerzentrierten nationalstaatlichen Institutionen.
Neuere internationale frauenpolitische Studien zeigen: Geschlechterdemokratie benötigt mindestens drei Bereiche, um verwirklicht werden zu können. Notwendig sind zum Ersten öffentliche Räume der Diskussion über "Fraueninteressen". Es ist offensichtlich, dass es "die" Interessen aller Frauen nicht gibt, dass vielmehr die Interessen von Frauen sehr vielseitig sind und im Widerspruch zueinander stehen können. Deshalb kommt es besonders darauf an, dass es Institutionen und Verfahren gibt, die festlegen, wie über solche Interessen diskutiert und gestritten werden kann. An einer solchen Frauenöffentlichkeit müssen ganz unterschiedliche frauenbewegte Gruppen beteiligt werden, damit ein aktiver Prozess der Interessenartikulation in Gang gesetzt werden kann.
Zweitens bedarf es Institutionen der Vermittlung von frauenbewegten deliberativen Öffentlichkeiten in das politische System hinein. Es braucht also nicht allein Frauen in repräsentativen Entscheidungsorganen oder in Ministerien, sondern es braucht vor allem Frauen (und auch Männer), die im Parlament und in der ministeriellen Verwaltung frauenpolitische Interessen vertreten und diese dann im Politikprozess lebendig halten und durchsetzen. Die qualitative Repräsentation von Frauen – das aktive Handeln für die Interessen und Bedürfnisse von Frauen – braucht also gleichstellungspolitische Institutionen wie ein eigenes Frauenministerium, Gleichstellungsstellen, Frauenbüros sowie rechtlich gesicherte Instrumente einer Gleichstellungspolitik und umsetzbare Frauenförderprogramme.
Drittens bezeichnet Demokratie nicht nur die "Verfahren" der Repräsentation, sondern hat unmittelbar mit den Lebensbedingungen unterschiedlicher Menschen zu tun. Ein schwacher Begriff von Demokratie, der lediglich auf die Institutionen und Verfahren der Parteiendemokratie abzielt, kann die akuten Probleme westlicher Demokratien nicht mehr angemessen lösen: Staatsbürgerschaft, also die aktive politische Teilnahme, bedarf gleicher sozialer Teilhabe. Anders formuliert: Erst das "empowerment" von Frauen zur Politik, also soziale Gleichstellung durch die Verfügung über Zeit und ökonomische Ressourcen, ermöglicht auch ihre politische Selbstbestimmung, also Souveränität im ursprünglichen Sinne des Begriffs Demokratie. Zu einem feministischen Demokratiebegriff gehört deshalb mehr als die quantitative Repräsentation von Frauen. Er umfasst ganz zentral die Herstellung von gleichen sozialen Bedingungen der Partizipation für Frauen und Männer: Politische Demokratie erfordert somit notwendig soziale Gleichheit. Geschlechterdemokratisierung muss also vor allem an der Verteilung von Arbeit – von Erwerbswie auch von Fürsorgearbeit – und den damit verbundenen Benachteiligungen ansetzen. Ein "neuer", demokratischer Geschlechtervertrag muss Gerechtigkeit der Verteilung von Arbeit, einerseits von gesellschaftlich notwendiger Fürsorge- und Pflegearbeit, andererseits von Erwerbsarbeit, zum Inhalt haben.
Birgit Sauer

(Foto: Otto Penz)
Stefanie Wöhl